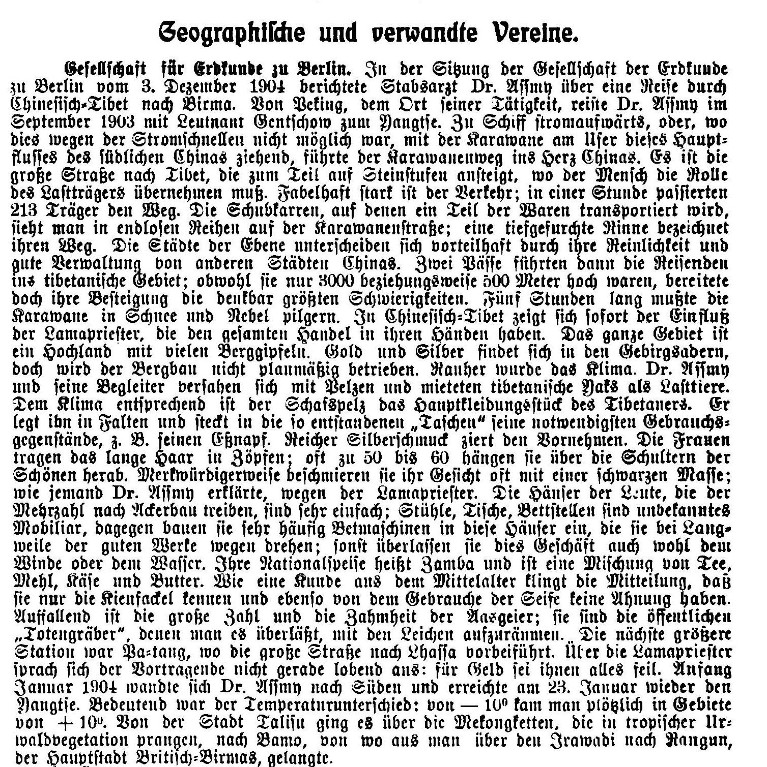Vorwort
Die im Anschluss an die Dienstzeit in China von Dr. Assmy und A. Genschow geplante Reise führt durch die Provinzen Tschili, Honan, Hupay, Szechuan und Yünnan. Die Dauer der Reiseroute wird mit 104 Tagen großzügig geplant, doch während Reise treten unvorhersehbare Ereignisse ein, die diese Zeitrechnung umwerfen. Mit zweimonatiger Verspätung erreichen sie im März 1904 ihr Ziel Colombo und reisen von dort über Genua und Neapel nach Berlin zurück, wo sie am 01.04.1904 ankommen.
Die Reisevorbereitungen, die Beschaffung sowie Zusammenstellung des Reisegepäckes nehmen Dr. Assmy und A. Genschow getrennt voneinander vor. Beide treffen erst in Langfang, gelegen in der Mitte zwischen Tientsin und Peking, aufeinander.
Genschow startet am 20.09.1903 am Bahnhof in Tientsin. In seiner Begleitung befindet sich sein Boy Djo Hoan Djang , den sie mit seiner Zustimmung Fritz nennen. Fritz kann durch den Besuch der Deutschen Schule in Tientsin auch etwas Deutsch lesen, schreiben und sprechen, wodurch er sich als Dolmetscher sehr gut eignet. A. Genschow bezeichnet ihn in seinem Buch als ehrlichen Rechnungsführer, Friseur, Koch, Einkäufer und bewährte Stütze. Er wird später A. Genschow und Dr. Paul Assmy nach Deutschland begleiten

Djo Hoan Djang „Fritz“
(Bildquelle : Unter Chinesen und Tibetanern von A.Genschow)
Der weitere Begleiter ist der ehemalige Briefträger des Deutschen Lagers namens Li fu Zei. Neben der Reiseausrüstung hat die Gruppe zu Beginn der Reise noch Jagdhund Carlo, 2 Mongolen-Ponys als Reitpferde sowie ein Packpferd dabei. Die Mongolen-Ponys müssen im Zuge der Reisevorbereitungen an das gängige Kauliang (Art der Sorghumhirse) und Maisfutter gewöhnt werden.
In Langfang schließt sich Dr. Paul Assmy mit seiner Ausrüstung, einem Packpferd und zwei weiteren Reitponys, wovon eines für Li fun Zei gedacht ist, seinen Reisebegleitern an.
Die fürstlich eingerichtete Wohnung im Deutschen Lager in Peking ist die letzte Bequemlichkeit auf dieser Reise.
Am Tag vor der Abreise aus Peking wird das Riemen- sowie Sattelzeug kontrolliert und repariert. Kleinere Einkäufe vervollständigen die bereits vorhandene Reiseausrüstung. Hierbei ist das Feilschen ein Muss und am Ende wird das Dreifache weniger gezahlt.
Die Reiseausrüstung besteht u.a. aus:
Kartenmaterial, Kompass, Aneroidbarometer(Messgerät zur Bestimmung des Luftdrucks ohne Flüssigkeit), Thermometer,
Zeiß-Fernglas
30 Militärrationen bestehend aus Büchsenfleisch und Erbenkonserven, einige Pfund Schokolade
Insektenpulver, Arzneien
Pfeife, Tabak, Zigarren, Zigaretten
Kleidung, Wäsche, Näh- und Flickzeug
Schlafsack und –decke, wobei letztere am Tage als Reitdecke genutzt wird
Karabiner 88 (Gewehr mit verkürztem Lauf) mit 400 Patronen
Jagdgewehr mit 300 Patronen
Pistole mit 50 Schuss
Empfehlungsschreiben des Taotai ( ähnlich einem Bezirkshauptmann, chinesischen Bürgermeister) aus Tientsin
Der schwerste Teil der Ausrüstung ist die fast 90 Pfund schwere Reisekasse, bestehend aus kleinen Silberbarren, den sogenannten Silberschuhen. Ein Silberbarren entspricht 1 Unze oder 1 Tael. Ein Tael entspricht dem Wert von ca. 1000-1.200 Käsch (Wechselgeld), wobei der Wert abhängig von der Gegend schwankt. Die Käsch-Münze ist mit einem viereckigen Loch in der Mitte versehen und wird auf einer Schnur oder einem Draht in einer Doppelreihe zu je 500 Münzen aufgefädelt.

Unterwegs gestaltet sich gerade der Transport der Tiere mit Dschunken und dem Zug als schwierig. Mitunter verweigern die Maultiere die Dschunken zum Überqueren der Flüsse zu betreten. In Hankau trennen sich die Reisekameraden kurzweilig, denn der Dampfer will die Ponys und Maultiere nicht transportieren.
Dr. Paul Assmy soll bis zum nächsten Treffpunkt mit dem Dampfer weiterreisen, während A. Genschow die Tiere auf dem Landweg weiterbringt. Kurz nach dem Aufbruch muss A. Genschow den Fluss Han überqueren. Ein Unternehmen, dass scheitert, denn die Tiere weigern sich die kleinen Dschunken zu betreten und eine größere steht nicht zur Verfügung. A. Genschow kehrt zurück nach Hankau und trifft dort wieder auf
Dr. Assmy. Hier schließt sich mit Hauptmann Diez, ein weiterer Deutscher, der Reisegruppe an. Die Tiere werden bis auf 3 Maultiere verkauft und mit ihnen kann die Reise auf dem Dampfer fortgesetzt werden.
Das Maultier mit der Geldkiste kommt während der Reise mehrfach abhanden, wird aber jedes Mal samt vollständiger Geldkiste wiedergefunden.
Die Mahlzeiten werden so oft es geht ergänzt durch Hähnchen, selbst geschossene Tauben und manchmal einen Fasan.
In Wan-hsien trifft die Reisegruppe auf den Missionar Taylor von der China Inland Mission und seine Ehefrau, die ihnen für die Weiterreise selbstgebackenes Brot mitgibt. In Tschöng-tu-fu werden die Reisenden vom dortigen englischen Konsul Horsie empfangen und zum Abendessen eingeladen. Sie erhalten von ihm als auch vom Bischof der französischen Mission wertvolle Ratschläge für die Weiterreise.
Auch hier noch einmal der Hinweis, dass hinsichtlich der angegebenen Örtlichkeiten unterschiedliche Schreibweisen vorgefunden worden sind.


Dr. Paul Assmy Hochsommer 1903


Als Vortrag von Dr. Paul Assmy gehalten am 16.07.1904, veröffentlicht in der
Zeitschrift für Ethnologie 1905, 37. Jahrgang Heft IV
und ergänzt mit weiteren Aufnahmen von Dr. Paul Assmy
Als im Hochsommer 1903 aus Deutschland bei der ostasiatischen Besatzungsbrigade die Nachricht eintraf, dass ein Teil der Offiziere abgelöst werden sollte, welche seit 1900 im fernen Osten Dienste getan hatten, fassten Leutnant A. Genschow, Dolmetscheroffizier des 1. ostasiatischen Infanterieregiments und ich, damals Oberarzt beim 2. ostasiatischen Infanterieregiment den Plan, von Seiner Majestät, dem deutschen Kaiser einen Reiseurlaub zu erbitten, um nach einem Aufenthalt von drei Jahren im Norden Chinas nun auch ein Stück des schönen Südens dieses interessanten Ländergebietes kennen zu lernen. Unsere Reisevorbereitungen konnten leider nur sehr unvollkommen sein. Das vorhandene Kartenmaterial war in kleinstem Maßstabe, es gab wohl die ungefähre Lage der großen Orte, nicht aber die Straßen an. Auch die Entfernungen erwiesen sich später so ungenau, dass unsere Zeitberechnung für die Reisedauer auch nicht entfernt richtig sich erwies. Da wir wissenschaftliche Zwecke nicht verfolgten, so nahmen wir nur Kompass, Barometer und Thermometer mit, zumal unsere Geldmittel für eine wissenschaftliche Expedition nicht annähernd ausreichten. Auch unsere persönliche Ausrüstung beschränkten wir möglichst, so dass wir alles auf drei Tragtieren mitführen zu können hofften. Als Diener begleiteten uns zwei Chinesen, beide aus Tientsin stammend. Unser Bargeld mussten wir in Silberbarren, den bekannten Silberschuhen mitführen, unsere Reisekasse wog 87 Pfund und bildete den unbequemsten Teil unseres Gepäckes. Bei jeder Zahlung musste das Silberstück abgewogen werden, das Wechselgeld bestand in Käsch, jenen in der Mitte mit einem viereckigen Loch versehenen Kupfermünzen des Chinesen, welche auf einer Schnur oder einem Draht aufgezogen werden. Da ein Tael d. h. etwa 2,70 Mk (Mark), je nach der Gegend 1000—1200 Käsch gilt und diese Summe Kupfergeld 7,5 Pfund wiegt, ein Reisender in China aber stets größere Beträge in Kupfer bei sich führen muss, um dem ewigen Wechseln und Betrogen werden zu entgehen, so bildete die Fortschaffung unserer Kasse stets eine Hauptsorge.

An Proviant nahmen wir nur 30 Militärrationen (Büchsenfleisch und Erbsenkonserven) sowie einige Pfund Schokolade mit, da wir hoffen konnten, auf dem größten Teile unseres Weges aus dem Lande leben zu können.
Am 22. September 1903 bestiegen wir in Peking die Pe-Han-Railway, die Bahn, welche Peking mit Haukau am Yangtsekiang verbinden und späterhin Anschluss an die Bahnstrecke Kanton - Haukau erhalten soll. Diese Bahn wird nicht nur eine ungeheure Revolte in wirtschaftlicher Beziehung in China hervorbringen, sie wird wohl auch die Nordchinesen und die Bewohner der Südprovinzen einander näher bringen, sie wird vielleicht den Gedanken der Volksgemeinschaft, der jetzt nur bei ganz wenigen, hellen Köpfen Wurzel geschlagen hat, wird das Rassengefühl wecken und so, wer kann es wissen, einmal ein Faktor werden für eine Einigung Chinas, die sich vielleicht verhängnisvoll für die europäischen Eindringlinge gestalten dürfte.
Wir fuhren am ersten Tage so weit, als die Bahnlinie fertig gestellt und dem Verkehr übergeben war, über Pautingfu, das alte Boxernest, hinaus, südlich bis Schun-te-fu, wo wir nach einer ziemlich raschen Fahrt von 350 km abends anlangten und von den lngenieuren der Bahn, Belgiern und Franzosen, in liebenswürdigster Weise untergebracht wurden.
Am nächsten Tage begann der Marsch. Wir zogen auf der sogenannten Kaiserstraße hin, derselben, welche der nach Peking zurückkehrende Hof im Januar 1902 gezogen war. Eine Telegraphenlinie begleitet ihn, und alle 5 km stehen jetzt verfallene Wachthäuser und Türme, welche Entfernungsangaben tragen. Das ganze Land ist völlige Ebene, in chinesischer Manier nach Art eines Gartens sorgfältig bebaut und mühsam bewässert. Gebaut wird hauptsächlich Mais, ferner Kauliang, eine sehr hochhalmige Hirseart, etwas Gerste, viel Baumwolle und Indigo, weiter südlich fanden wir auch schon an wasserreichen Plätzen etwas Reisbau. Das ganze Land macht genau denselben Eindruck wie die Ebene um Peking herum, alles ist bebaut, nur in und um die zahlreichen Dörfer herum stehen einzelne Baumgruppen.

Wir quartieren uns in dem, in jedem Dorf vorhandenen Gasthaus ein; meist sind es fabelhaft schmutzige, von Ungeziefer wimmelnde Buden, aber wir müssen hinein, denn wir haben aus Einschränkungsgründen keine Zelte mitgenommen. Nach einigen Tagen Marsch erreichen wir das Gebiet des Hoang-ho, des gelben Flusses. Öde, wüstenartige Sandflächen rufen in uns die Erinnerung an die häufigen großen Überschwemmungen dieser Wasserader wach, welche von Zeit zu Zeit die Bevölkerung dieser Landstriche der Provinz Honau dezimieren und das Land meilenweit mit Sand und Lehmschlamm bedecken.


Das Übersetzen mit einer Dschunke
Wir kamen zur Zeit des niedrigen Wasserstandes an den Fluss, aber die gewaltigen Vor-und Hauptdämme bewiesen uns, was aus dem jetzt etwa 1500 m breiten, schmutziggelben Fluss werden kann. Am gleichen Tage erreichen wir Kai-föng-fu, die Hauptstadt von Honan. Die Honanesen sind ein sehr leicht aufgeregter, kriegerischer Volksstamm. Räubereien scheinen an der Tagesordnung zu sein, denn jede der zahlreichen Karawanen, denen wir begegneten, war von einer militärischen Eskorte begleitet, jeder einzelne Wanderer trug ein Schwert oder einen Spiess, den er gewöhnlich als Tragestange für sein Reisegepäck benutzte. Übrigens schienen sie, wohl durch die Bahningenieure, an den Anblick der Europäer gewöhnt zu sein, denn nur einmal vernahmen wir den Ruf: Yang-guetze, fremder Teufel.
Das Land und die Bevölkerung zeigten wenig Interessantes, so dass wir froh waren, in Si-ping am 5. Oktober 1903 den südlichen Abschnitt der Pehanbahn zu erreichen. Das Entgegenkommen der Bahningenieure ermöglichte es uns, von hier aus in drei Tagen Haukau am Yangtsekiang zu erreichen.
ln Hankau trafen wir mit Hauptmann Diez von der ostasiatischen Besatzungsbrigade zusammen, welcher den Hauptteil unserer Reise mit uns zusammen durchführte. Nach einem achttägigen Aufenthalt, den wir zu Vorbereitungen und Einziehung von Erkundigungen über unsere Reiseroute sehr nötig hatten, fuhren wir den Yangtse-kiang aufwärts bis Itschang, wo Herr Dr. Betz (Anmerkung: Dr. Heinrich Betz war Dolmetscher an der Deutschen Botschaft in Peking), ein alter Pekinger Bekannter, die Geschäfte eines deutschen Konsuls wahrnahm. Hier mussten wir unsere Karawane auf neuer Grundlage zusammenstellen. Denn von nun an führte unser Weg fast ununterbrochen in Gebirgsland, das für Tragtiere nicht gangbar ist. Unser Gepäck verluden wir auf von je zwei Chinesen fortgeschafften Bambustragen, behielten jedoch entgegen den Einreden der Landeskundigen unsere drei Maultiere, mussten aber schon sehr bald einsehen, dass wir damit einen Fehler begangen hatten.



Der von uns gewählte Weg führt durch das Gebirge südlich des Yangtse, er umgeht die gefürchteten Stromschnellen dieses Flusses oberhalb Itschang. Die Wegrichtung kreuzt die Richtung der Bergzüge meist rechtwinkelig, nur selten ist es möglich ein Flusstal eine größere Wegstrecke lang zu verfolgen, meist klettert der größtenteils aus Steintreppen bestehende Pfad einen Bergrücken hinan, verläuft oben mehr oder weniger weit auf dem Kamm, biegt vielleicht auf einen sich abzweigenden Bergriegel über, um oft in steilem Abfall, in Serpentinen oder auch geradeaus in das jenseitige Tal hinabzusteigen.



Die Gegend ist sehr malerisch, tief eingeschnittene, geröllerfüllte Flussbetten trennen die einzelnen Gebirgszüge voneinander, oft sehr kunstvoll aus Holz oder Stein erbaute Brücken überspannen in hohem Bogen die zur Zeit unseres Vorbeimarsches wasserarmen Bachbetten.





Holzbrücke mit Dach, Hupeh

Wan-li-chiau (10.000 Zinsen- Brücke), Hupeh
Unser Pfad, der sogenannte „große Weg", d. h. die am meisten begangene Karawanenstraße dieser Gegend, in Wirklichkeit meist ein schmaler, mit Steinplatten belegter Pfad von etwa 1,50 m Breite läuft im Tal zwischen den unter Wasser stehenden Reisfeldern dahin, die Bergrücken hinauf verwandelt er sich in eine schier endlose Folge von Steinstufen, welche die beständig in Gestalt eines dichten Nebels oder feinen Regens sich niedersenkende Feuchtigkeit der Luft so unangenehm glatt macht, dass unsere armen Tiere eigentlich fortwährend im Gleiten sich befinden. Da außerdem der Chinese grundsätzlich an Wegen nur dann Ausbesserungen vornimmt, wenn der Verkehr gänzlich unterbrochen ist, so befindet sich der große Weg stellenweise in einem trostlosen Zustande. Hier fehlen auf viele Meter hin die Steinplatten, sie sind im Moraste der Reisfelder versunken und der unglückliche Reisende patscht durch den Sumpf, in steter Gefahr in einem angrenzenden Reisfeld zu versinken. An einer anderen Stelle, wo der Weg hart an einem 10—15 m hohen Steilabfall entlang führt, sind einige Platten in die Tiefe gerutscht, aber jeder Reisende turnt mit Seelenruhe über die gefährliche Stelle fort, und die Einwohner oder der Mandarin der Gegend denken: warum Geld ausgeben für eine Ausbesserung, solange es noch ohne dieselbe geht.



Dabei ist der Verkehr geradezu erstaunlich. Aber alle Waren, ja auch die Reisenden werden getragen. Wer hier reitet, ist Reisender zweiter Klasse und wer zu Fuß geht, der kann auf Berücksichtigung seitens der Herbergswirte und Reisenden überhaupt keinen Anspruch machen. Die Lasten werden meist an Tragstangen auf der Schulter befördert, aber auch hier schon sieht man die weiter im Innern beliebte Beförderung von Waren mittels Rückentragegerüstes, Opium, Baumwolle, Salz und Tabak bilden die Haupthandelsartikel.


Die Ortschaften sind meist kleine Gebirgsdörfer, oft ist nur eine Reihe von Häusern an die Berglehne angeklebt, häufig führt der Pfad sogar mitten durch ein Haus hindurch. Abends schließen dann die Leute die Tore und sperren so den Verkehr für die ganze Nacht. Trotz der Kleinheit der Ortschaften sind die Herbergen verhältnismäßig gut. Wir trafen es insofern günstig, als ein hoher chinesischer Beamter im Jahre vorher auf seiner Versetzungsreise hier durchgezogen war und alle Herbergen für ihn in Stand gesetzt worden waren. Tische, Stühle und Brettergerüst für das Lager, belegt mit Strohmatten, waren fast immer vorhanden, wenn auch bisweilen in sehr verwahrlostem Zustande.

Die Beleuchtungsfrage ist hier nur sehr mangelhaft gelöst: der einzige Beleuchtungsapparat ist eine offene Ölschale, in welche einige Dochte aus Baumwollfasern oder aus Binsenmark eintauchen. Den Luxus von Lichten leisten sich nur reiche Leute, wir führten stets einen Vorrat an chinesischen Lichten mit. Dieselben bestehen aus einem Holz- oder Bambusstabe, welcher mit einem von einer Binsenart gewonnenen Docht umwickelt und mit Talg umgossen ist. Diese Lichte qualmen und duften übel, geben dafür aber umso weniger Licht. Der Chinese hält aber unentwegt an dieser Herstellungsweise fest, ja, diese Lichter sind ein Luxusgegenstand und fehlen selten unter den Geschenken, welche vornehmere Reisende von den Ortsmandarinen erhalten.
An Nahrungsmitteln liefert das Land herzlich wenig dem europäischen Gaumen zusagendes. Fleisch ist sehr selten zu erhalten, Hühner, Eier und Reis bilden unsere tägliche Kost, sind aber häufig auch sehr teuer. Die Einwohner und die Träger leben fast ausschließlich von Reis und Bohnenmehlkuchen (do-fu). In den höher gelegenen Ortschaften war Reis überhaupt nicht erhältlich, an seine Stelle trat dann der Mais. Das Nationallaster ist das Opiumrauchen, alles raucht, Männer und Weiber. Ein Haus verrät sich schon auf mehrere hundert Meter durch seinen Opiumgeruch, und in den Herbergen waren wir häufig gezwungen, unseren Mitgästen die Opiumlampen auszublasen, um nicht durch den faden süßlichen Geruch allzu sehr belästigt zu werden.
Dabei ist der Menschenschlag kräftig, fast durchweg mittelgroße Leute aber breitschultrig und gedrungen. Die Männer tragen weite Kniehosen, die sehr muskulösen Unterschenkel sind mit Binden umwickelt, und an den Füssen werden Strohsandalen getragen. Die Frauentracht ist nahezu der nordchinesischen gleich. Auch hier herrscht die Unsitte, das Wachstum der Füße der Mädchen durch Bandagieren zu beeinflussen, wie wir denn überhaupt die allgemein verbreitete Annahme, dass die Südchinesen ihre Mädchen nicht bandagierten, auch in Südyünnan nicht bestätigt fanden. Die Frauen und Mädchen sahen hier aber, in wohltuendem Gegensatz zu denen im Norden, weit besser genährt und viel offener und weniger verängstigt aus.
Die Vegetation ist subtropisch, Bambus und Palmen, Musa und mächtige Farne stehen neben Koniferen aller Art, Weihmutskiefern, Lärchen, Lebensbäumen und Zypressen; dagegen finden sich nur wenige Laubbäume, einige Eichen, Kastanien und in größerer Zahl nur ein Laubbaum, aus dessen Früchten das Tuug-jo, ein Öl gewonnen wird, welches zu vielen Dingen benutzt einen Haupthandelsartikel bildet. In allen tieferen und wasserreichen Plätzen wird auf terrassenförmig übereinander angelegten Feldern Reis gebaut, auf den höheren Bergen und in wasserarmen Gegenden Mais, daneben bilden die Hauptfeldfrüchte Bohnen und Pfeffer dessen rote leuchtende Schoten in langen Girlanden die Fronten der Dorfhäuser schmücken.


Bewässerte Reisfelder in Szechuan

Pflügen eines Reisfeldes mit einem Wasserbüffel in der Provinz Hupeh
Nach neunzehntägigem Marsch erreichten wir den Yangtsekiang bei Wan-hsien wieder. Wan-hsien liegt oberhalb der Stromschnellen und ist der Ausgangspunkt für den Handel nach
Sze-chuan hinein.

Brücke in Wan-hsien
Sze-chuan ist eine der reichsten Provinzen des chinesischen Reiches, es bringt einerseits eine Fülle von Rohprodukten hervor, andererseits ist es der Sitz einer Reihe von wichtigen Industriezweigen, deren oberster die Seidenfabrikation ist. Das Hauptlandesprodukt ist Reis.
Von den niedrigen Höhenrücken aus gesehen sieht das Land wie ein Meer aus, in welchem die in Baum- und Bambusgruppen liegenden Dörfer sich wie Inseln ausnehmen. In einigen Gegenden wird viel Salz gewonnen. Aus tief in das Erdinnere getriebenen Bambusrohren wird mit einem Hebewerk Salzlake gehoben. Dieselbe wird eingedampft und das so gewonnene Salz teils gereinigt, teils ungereinigt weithin verkauft.
Die Brunnen gehören den Gemeinden, wie aber diese Art Genossenschaftsbetrieb vor sich geht, konnten wir leider nicht feststellen. Ein Hauptindustriezweig ist auch die Papierfabrikation aus Bambus. Der Bambus wird in Gruben mit Kalk zusammen mazeriert, dann zerrieben und als Faserbrei in Bottiche getan. Mittels eines feinmaschigen Siebes schöpft der Papiermacher eine Quantität dieses Stoffes heraus, das Wasser läuft ab, der Faserstoff verfilzt auf dem Drahtsieb, wird abgehoben, und ein Bogen groben Papiers ist fertig. Die Provinz Shensi ist ein Hauptabnehmer für Papier, ja auch nach Peking wandert es, oft gold- und silberbemalt als Opfergegenstand bei Leichenbegängnissen, Hochzeiten usw.
Die Häuser sind oft sehr schön bemalt, vielfach sieht man die Giebel mit Drachen, Fischen und Fabeltieren geschmückt, die teils in Malerei, teils in Hochrelief dargestellt sind. Sehr verbreitet ist auch die Sitte, wohlverdiente Beamte nach ihrem Fortgange oder Tode durch Errichtung eines Ehrenbogens, Pei-lo zu ehren. Bisweilen sind diese Pei-los prächtige Bauten, aus reich skulpturierten und bemalten Steinblöcken hergestellt, an denen Inschriften, Rang und Verdienste der also Geehrten der Nachwelt verkünden.


Pei-lo, Ehrenbogen für einen verdienstvollen Beamten
Die Sze-chuanesen begraben ihre Toten gern in die Berge hinein und schmücken den Eingang zu diesen Grabstollen mit hübschen bunten Pforten aus Steinblöcken.- Solch ein Begräbnisplatz macht oft einen sehr netten freundlichen Eindruck. Sehr merkwürdig nahm ein offenbar christliches Grab mit Kreuz und einer Darstellung der Grablegung Christi mitten zwischen chinesischen Gräbern aus. Vielleicht war ein Mitglied der Familie Christ gewesen und hatte sein Ruheplätzchen sich dennoch bei seinen Lieben ausbedungen.
Der reichste und fruchtbarste Teil des gesegneten Sze-chuan ist die vom Minfluss durchströmte Ebene in welcher die Provinzialhauptstadt Tschöng-tu-fu liegt. Umrahmt von nicht sehr hohen Bergzügen, deren Abhänge mit fruchtbaren Orangenplantagen bedeckt sind, liegt diese Ebene wie ein großer wohlbewässerter Garten vor dem Auge des Wanderers. Schon vor Jahrhunderten hat ein angesehener Beamter prinzlichen Geblütes durch ein mächtiges Stauwerk den im Nordwesten der Ebene einfließenden Minfluss gezwungen, sich in eine Unzahl großer und kleiner Wasseradern zu teilen, welche so die weite Ebene wie ein Netzwerk durchziehen und den landbauenden Chinesen stets Wasser in Hülle und Fülle darbieten. Schmale Steinstraßen nur durchziehen die mit Feldfrüchten aller Art bebauten Äcker und auf ihnen wogt beständig eine ungeheure Menge geschäftiger Wanderer, reich geschmückter Sänften, knarrender Schiebkarren und glockengeschmückter Pferde und Maultiere hin und her. Alles deutet auf Wohlhabenheit und Betriebsamkeit. Je näher man der Hauptstadt Tschöng-tu-fu kommt, umso reger wird das Treiben.


Tchöng-tu ist der interessantesten Städte Chinas eine. Mitten im Reiche gelegen durch weite beschwerliche Wege und unwirtliche Gebirge vom Verkehr mit der Küste und dem Einfluss abendländischer Kultur abgeschnitten, zeigt es, welchen hohen Grad chinesische Kultur erreichen kann. Keine chinesische Stadt macht einen so imposanten Eindruck, keine zeigt so wenig Verfall, Schmutz und Vernachlässigung. Nirgends sieht man so gut gekleidete und wohlgepflegte Menschen und nirgends bleibt man von Krüppeln und Bettlern so verschont wie hier. Wohlhabenheit, Fleiß und Intelligenz drücken dem Ganzen ihren Stempel auf. Kaufladen reiht sich an Kaufladen, Handwerksstätte an Handwerksstätte, hier ist eine Pelzhändlerstraße, hier eine Schuhmacherstraße, hier eine Straße, wo Laden an Laden die kostbarsten Gold- und Silbersachen feilgeboten werden. Von Zeit zu Zeit unterbricht die Reihe der Läden der große, buntbemalte von Steinlöwen flankierte Torbogen eines Amtsgebäudes. Denn in Tchöng-tu-fu ist der Sitz der Provinzialregierung, hier führen alle die verwickelten Fäden der chinesischen Verwaltung zusammen. Jetzt ist natürlich auch abendländische Kultur eingezogen; England und Frankreich haben ihre hervorragendsten Generalkonsuln nach Tchöng-tu-fu geschickt, in der richtigen Erkenntnis, welch Reichtum im Lande und welcher Unternehmungsgeist in den Bewohnern steckt.
Seit vielen Jahrzehnten schon wetteifern Engländer und Franzosen miteinander, die einen von Birma, die andern von Tonkin her sich einen gangbaren Weg nach Yünnan und Sze-chuan hinein zu bahnen, um die ungehobenen Schätze dieser Länder zu erschließen und sich zugänglich zu machen. Neben den Konsulaten haben natürlich eine Anzahl Missionsanstalten ihren Sitz in Tschöng-tu-fu. Den größten Einfluss scheinen die Franzosen hier zu haben, es soll der französischen Mission ein nicht unbeträchtlicher Teil von Tschöng-tu-fu und seinem Gebiet eigentümlich gehören. Frankreich hat sogar, was sonst kein Staat hat, hier einen Marinearzt (1903 Dr. Légendre) stationiert, welcher dem Missionshospital vorsteht, und will sogar ein von der Mission getrenntes Staatshospital einrichten. Die Seidenindustrie nimmt eine herrschende Stelle in Tschöng-tu-fu ein, daneben sind aber Tabak-, Baumwolle- und Reisbau ebenfalls sehr bedeutend. Erstaunlich ist, welch eine Fülle abendländischer Artikel man in Tschöng-tu-fu kaufen kann. In zwei von Chinesen eingerichteten Läden kann man Zigarren, Weine, Kurzwaren, deutsche Lampen, Anilinfarben, Kakao, Schokolade, Kinderspielzeug, kurz, eine ganze Reihe von amerikanischen und europäischen Luxus waren kaufen und zwar trotz der hohen Binnenzölle und trotz der doch weit über 1000 km betragenden Entfernung von der Küste um nur 30 pCt. teurer als in Shanghai.
Am 1. Dezember 1903 verließen wir Tschöng-tu-fu und zogen südlich uns wendend, weiter durch die Ebene, bis wir die Vorberge des bei klarem Wetter schon des Öfteren in weiter Ferne schneebedeckt herüberwinkenden Hochlandes erreichten. Auf mannigfaltigen Brücken und Fähren kreuzten wir die zahllosen Flussläufe und Rinnsale, welche sämtlich ihr Wasser dem Yangtsekiang zuführen. Nach einem Marsch von 5 Tagen erreichten wir den Hauptteeplatz für diese Gegend Ya-chau am Ya-ho, den wir auf einem auf schwimmenden Bambusstangen ruhenden Stege überschritten.



In der ganzen Gegend wird Tee gebaut, außerdem wächst aber auf allen Bergen eine wilde Teeart. Schneetee, Chüe-tscha genannt, dessen Blätter- und Blütenzweige ebenfalls gesammelt und nach Tibet verhandelt werden. In Ya-chau sind eine ganze Reihe von Teefirmen. Hier wird der gesammelte Tee durch Gärenlassen und Räuchern fertiggestellt, dann mittels sehr primitiver Handpressen in Stücke oder pan von 2—5 Pfund gepresst, diese dann zu vier oder fünf in Matten genäht und auf dem Rücken von Trägern versendet. Die Straße nach Ta-tsien-lu wimmelt förmlich von diesen Teeträgern, welche oft erstaunliche Lasten tragen. Die gewöhnliche Durchschnittslast eines ausgewachsenen Mannes beträgt 190—220 Pfund. Wir sahen jedoch Leute, welche 300 Pfund und mehr schleppten. Die Teepacken sind eins über dem andern auf einer Kraxe befestigt, so dass die obersten Packen über den Kopf des Mannes sich vorwölben. Mittels einer Schnur hält er die hohe Last im Gleichgewicht.

Jeder hat eine eisenbeschlagene hölzerne Krücke, die wie ein kleiner Eispickel gestaltet ist, in der Hand, mit welcher er sich stützt und auf welche er seine bepackte Kraxe aufsetzt, wenn er sich ausruhen muss. So groß ist die Zahl der Träger, dass sie durch das Aufstemmen ihrer Krücken in den festen Steinstufen, welche hier wiederum den größten Teil des Weges ausmachen, ganze Reihen von Vertiefungen ausgebohrt haben. Der Weg führt über zwei recht ansehnliche 3000 m hohe Bergpässe, deren einer, der Fei-yüe-ling, an Schwierigkeit selbst die weit höheren Pässe im tibetanischen Grenzgebiet beträchtlich übertraf. 5 Stunden stiegen wir in dichtem Nebel auf zuerst nassen und schlüpfrigen, dann vereisten und mit 3—4 Zoll Schnee bedeckten engen Bergpfaden hinan. Gespensterhaft tauchen vor uns Träger auf, dann ertönt Glöckchenklang, eine Maultierkarawane kommt uns entgegen, es sind Shensileute von Lan-tschu-fu — weitgereiste Leute.


Unsere Leute legen Steigeisen an, da der Weg oft völlig vereist ist und ein Ausgleiten einen Absturz in den Abgrund neben dem Weg nach sich ziehen kann, dessen Tiefe man des Nebels wegen nur ahnen, nicht schätzen kann. Auf der Passhöhe steht ein kleiner Tempel, ein Unterschlupf, um für einen Moment dem eisigen Wind zu entgehen, der die Pfosten und Wände mit Eiskristallen bedeckt und den einzigen Vertreter der Zivilisation hier oben, den nach Ta-tsien-lu führenden Telegraphendraht, in einen zolldicken mit Eisnadeln besetzten Strang verwandelt hat. Zum ersten Male sehen wir hier tibetanische Schriftzeichen an den Wänden, wie wir später lernen, das allgegenwärtige sechssilbige Gebet:
Om mani padme hum.
Von Reiten ist natürlich gar keine Rede, wir sind froh, dass unsere armen Tiere sich nicht alle Knochen auf dem fürchterlichen Wege zerbrechen. Wer in Rockhills Buch „The Land of the Lamas" die Anmerkung dieses Forschers liest, dass er keinerlei Schwierigkeiten an diesem von einem chinesischen Autor als entsetzlich beschriebenen Pass gefunden habe, der denke daran, dass Rockhill im Hochsommer hier entlang zog. Ich kann mich dem Urteil des Chinesen nur anschließen.
Nach diesen recht anstrengenden Märschen erreichten wir den Da-du-ho oder Tung-ho, die hydrographische Grenze von China und Tibet. Jenseits dieses Flusses beginnen die Berge, die nach Verlauf, Gestaltung und Gesteinsart sowie nach der Nationalität ihrer Bewohner schon zu Tibet gerechnet werden müssen. Bei Luting überschreiten wir den Fluss auf einer der berühmtesten, nach Erklärung eines Mitgliedes der Mission Iyonnaise in Hankow berüchtigtsten Kettenbrücken.

Kettenbrücke

Hängebrücke, Yünnan
Neun Ketten überspannen in einer Länge von 125 m und 3,5 m Breite zwischen zwei Brückenköpfen etwa 30 bis 40 m hoch über dem Flussspiegel den hier sehr reißenden Da-du-ho. Dünne Brettchen sind nur höchst problematisch befestigt quer über die Ketten gelegt, ein dünnes lückenhaftes Geländer gibt dem armen Passanten ein ganz geringes Gefühl der Sicherheit. Die ganze Geschichte ist außerordentlich „nervenkitzelnd“, denn sowie man einige Schritte vorwärts gemacht hat, beginnt der luftige Bau zu schwanken, in senkrechter und waagerechter Richtung schwingt die Brücke. Dabei sieht man, wie die dünnen Brettchen sich biegen, wie sich hier ein Ende verschiebt und von der Kette abzugleiten droht. Hier fehlt ein Stück des Brettes und durch die Lücken und neben der Brücke, die dem Passanten trotz der 3,5 m sehr schmal vorkommt, sieht man unten 40 m tief die kalten, grünlichen Fluten des Da-du-ho rauschend dahinschießen. Wer schwindlig ist, der bleibe fort oder lasse sich von den Chinesen mit verbundenen Augen hinüber tragen. Unsere Tiere liefen einzeln, fast ohne zu stutzen hinüber. Ich muss sagen, nur die Überlegung, hier laufen täglich hunderte von Leuten hinüber und zwar seit vielen Jahren schon, nur diese Überlegung nahm mir das Gefühl: da gehst du nicht hinüber. Derartige Brücken trafen wir in Yünnau eine ganze Reihe, die Brückenhäuser sind bisweilen wunderbar schön geschmückt.

Inneres einer Kettenbrücke in Yünnan
Von Luting brachte uns ein Tagemarsch in scharf nördlicher Richtung nach Watze-ku, hier mündet das Flüsschen in den Dadu-ho, welches von Ta-tsien-lu herabkommt.




Dem klammartigen Tal dieses Flüsschens folgend stiegen wir auf sehr rauen Pfaden auf eine Höhe von 2500 m auf, damit unseren Einzug haltend in das tibetanische Hochland.
Ta-tsien-lu, der letzte Posten des chinesischen Kulturlandes gegen das Land der Barbaren, der Mantze oder Man-chia, liegt etwa auf dem 30. Breitengrade, 1500 km rund von der Meeresküste, fast 3000 m hoch über dem Meeresspiegel eingebettet in raue Felsberge, deren höchster und steilster, Le bonnet de cotton von den französischen Missionaren genannt, stets eine Schneemütze trägt. Dem Bau der Häuser und der Anlage nach noch völlig chinesisch, zeigt Ta-tsien-lu doch sehr starke Zeichen tibetanischen Einflusses in seiner Bevölkerung und seinem Verkehrsbilde. In den engen Gassen sieht man überall in rotwollene, togaartige Gewänder gehüllte, kahlgeschorene Lamapriester ; tibetanische Häuptlinge in leoparden-fellverbrämten Pelzen und goldbestickten Mützen ziehen mit ihrem weniger anmutigen Gefolge umher, um Einkäufe zu machen. Da chinesische Frauen und Mädchen wenig außer dem Hause sich sehen lassen, so gehören fast alle sichtbaren weiblichen Wesen dem einheimischen Stamme an. Ihre Kleidung ist nicht rein tibetanisch, sondern gemischt chinesisch-tibetanisch. In Gesichtstypus und ihrem offenen, wenig scheuem Benehmen erinnern sie sehr an die Mandschufrauen. Am Osttor flutet der fast nicht versiegende Strom der Teeträger in die Stadt hinein, gleich am Tor angehalten, um den Eingangszoll, das Likin für den chinesischen Beamten zu entrichten. Der Teehandel liegt hauptsächlich in den Händen der Yachaufirmen. Dann sitzen aber auch Kaufleute aus Likiang in Yünnan hier, die sogen. Yünnan-ko, Gäste aus Yünnan und auch unternehmende Händler aus
Lanschu-fu in Schensi sind hier zu finden. Hier wird der Tee neu verpackt, in Felle vernäht und auf dem Rücken von Maultieren, Pferden und Yaks nach Tibet verfrachtet. Am Westtor verlassen die Stadt täglich Karawanen von über 100 Tieren, 13,5 Millionen Pfund Tee werden nach Berechnung des Zollamts allein auf diesem Wege nach Tibet jährlich exportiert.
Das Land um Ta-tsien-lu herum führt den Namen Cha-la, es ist bewohnt von einem tibetanischen Stamm, den die Chinesen Man-tze nennen, sie selbst nennen sich Man-chia und halten Man-tze für ein Schimpfwort. Der Stamm hat seinen eigenen König, der unumschränkt über alle Man-tze herrscht, d. h, forensisch. Politisch steht das Land unter dem chinesischen Tau-tai von Ta-tsien-lu, da die Chinesen etwa um 1700 herum das Land okkupiert habe. Der König hat einen sehr interessanten Palast in der Stadt, ein umfangreicher Lamatempel befindet sich in demselben mit einer sehr schönen Darstellung des „Rades des Lebens“. Leider wurde uns nicht gestattet im Palast zu fotografieren, da der abwesende König ein Gegner dieser abendländischen Zauberkunst ist Mit dem hier seit etwa zwei Jahren stationierten Missionar der China-Inlandmission, einem Norweger, Namens Sörensen, verbindet den Mautzekönig der Bruderbund, der nach einheimischem Rituss geschlossen wird, indem die beiden Männer die auf ein Täfelchen geschriebenen Namen ihrer Eltern und Großeltern austauschen. Hr. Sörensen erzählte uns auch, dass die Berge um Ta-tsien-lu herum sehr reich seien an Gold, Silber, Kupfer und anderen Metallen, dass aber Gold nur durch Waschen des Flusssandes gewonnen werden dürfe. Alles Schürfen sei vom Mautzekönig verboten worden.
Nach Ansicht dieser Völker wächst das Gold, seine Wurzeln seien die Goldadern im Gestein, und durch das Abbauen der goldhaltigen Schichten würde die Quelle des Goldes vernichtet. Die Chinesen bauen auch nur ganz oberflächliche Stollen in die Berge hinein und geben bei dem geringsten Unfall, der sich ereignet, den Weiterbau auf. Sie meinen dann, der Erddrache sei über das Eindringen der Menschen entrüstet und habe deshalb den Gang verschüttet oder Wasser hineinlaufen lassen.
In Ta-tsien-lu mussten wir wiederum unsere Karawane umgestalten. In dem nun uns winkenden Hochlande können Menschen keine Lasten tragen, da Anstrengungen in diesen Regionen niederen Luftdruckes unmöglich sind. Durch Vermittlung des Herrn Sörensen und des Monseigneur Girandeau, des französischen Erzbischofs von Ta-tsien-lu, erlangten wir das sehr schätzbare Vorrecht, die Ula benutzen zu dürfen. Dies ist eine Art Frohndienst, welchen die Mitglieder eines Stammes ihrem Häuptling an Stelle einer Grundsteuer leisten müssen. Alle in staatlichem Auftrage reisenden Beamten, besonders der chinesische Amban, welcher nach Lhassa geht, um den Kaiser von China dort zu vertreten, erhalten durch die Ula Saumtiere mit Treibern von einer Station des Weges zur anderen. Wie überall in China sollen auch hier selbst Beamte für die ihnen gestellten Tiere und für die Verpflegung einen bestimmten Preis zahlen. Überall wird aber auch hier wie im übrigen chinesischen Reich vom Mandarin vielleicht gezahlt, von seinem Gefolge aber sicher ein um vieles höherer Betrag gesqueesed, d. h. von den Einwohnern erpresst. Andere Privatreisende bezahlen einen allerdings niedrigen Satz. Wir kamen mit etwa 80 Pf. für Tier und Tag davon. Es ist dies ein unendlicher Vorteil, denn man hat stets frische, berggewohnte Tiere, man braucht nicht für Futter Sorge zu tragen, und wenn ein Tier unbrauchbar wird, erfolgt die Gestellung eines Ersatztieres ohne Zeit- und Geldverlust. Späterhin gelangten wir in Gegenden, in denen die chinesischen Beamten angeblich verreist waren, und konnten des Ula-Vorrechtes nicht teilhaftig werden. Wir mussten eine Menge Geld aufwenden und hatten trotzdem die unangenehmsten Plackereien und Zeitverluste, um Tiere zum Fortschaffen unseres Gepäckes zu mieten.
Von Ta-tsien-lu an wechselte auch wieder einmal das Münzsystem. Bisher hatten wir stets in chinesischem Silber bzw. Kupfer bezahlt, hier tritt plötzlich die englische Rupie und die von den Chinesen in Tschöng-tu-fu neu geprägte chinesische Rupie in Kraft, welche mangels einer Scheidemünze bei Bedarf in Stücke geschnitten wird. Die Tibetaner wollen jetzt die neuen englischen Münzen mit dem Bilde Eduard VII. nicht annehmen, sondern wollen stets die alte Queen auf den Stücken sehen. Einheimische Münzen, die sogenannten Tankar, haben wir niemals zu sehen bekommen.
Nachdem wir uns und unsere Diener mit Pelzen ausgerüstet, sowie unser Gepäck so in Ledersäcke verstaut hatten, dass es auf Maultiere, Pferde und Ochsen verladen werden konnte, begannen wir am 19. Dezember 1903 den Weitermarsch hinein nach Tibet.



Alles Land westlich der Stadtgrenze von Ta-tsien-lu ist der Wirklichkeit nach tibetanisch, die Chinesen haben zwar um 1700 herum das Land bis Batang hin nominell in Besitz genommen, halten aber tatsächlich nur mit Mühe die Hauptstraßen, so vor allem die große Straße Tu-tsien-lu - Litang-Batang-Lhassa, mit Hilfe von großen und kleinen Militärposten besetzt. Jeden Aufstand jenseits Ta-Tsien-lu erklären sie demgemäß als Aufstand außerhalb des chinesischen Reiches. Das offene Land ist tibetanisch und steht unter der Herrschaft von Stammeshäuptlingen, die wiederum in einem gewissen Abhängigkeitsverhältnis zu den chinesischen Distriktsbeamten stehen sollten. Die wirklichen Herren im Lande sind die Lamapriester. Obwohl diese, welche sich in vier Sekten, die rote, gelbe, weise und schwarze, teilen, sich aus dem tibetanischen Volk rekrutieren, da jeder dritte, an manchen Orten sogar jeder zweite Familiensohn Lamapriester werden muss, so besteht dennoch ein ständiger, heimlicher Antagonismus zwischen ihnen und den Laientibetanern, der sich des Öfteren schon in blutigen Fehden Luft gemacht hat. Wie im Mittelalter die Klöster durch Schenkungen, durch Verpachten von Land und Ausleihen von Geld sich bereicherten, das Landvolk ausbeuteten und großen Einfluss auch in weltlichen Dingen sich zu erwerben wussten, so auch die Lamaklöster. Dadurch kam es damals und kommt es jetzt in Tibet zu Streitigkeiten zwischen den Mönchen und den Laien und auch zwischen den einzelnen Klostergemeinschaften untereinander, und noch heute setzt es oftmals blutige Köpfe bei Fehden zwischen zwei feindlichen Klöstern. Die Lamas herrschen im Lande, der chinesische Beamte ist, falls er nicht wie der Tautai von Ta-tsien-lu und der Hsien-Kuan (Distrikts-Beamter) von Litang ein sehr energischer Mann mit einer Truppenmacht hinter sich ist, eine minderwertige Persönlichkeit. Die Ulatiere werden von den Lamas besorgt, sie liefern Futter für die Tiere, Fleisch und Reis, Mehl, Butter und Salz für die Menschen, von ihnen muss man die Ledersäcke kaufen zum Verpacken aller dieser Sachen. Wie oft hörten wir nicht von den chinesischen Beamten: Ja, da muss ich zu dem Lama-Kloster schicken, ich habe keine Tiere zur Verfügung! Aber für Geld ist ihnen auch alles feil. Bei Tage allerdings gelang es uns nicht, auch nur ein tibetanisches Schmuckstück einzuhandeln, bei Dunkelwerden aber überstieg das heimliche Angebot bedeutend die Nachfrage, leider aber auch meist der geforderte Preis unsere Mittel. Viele Hindernisse legten sie uns nicht in den Weg, sobald sie erkannt hatten, dass unser Sinn nicht auf die Erreichung von Lhassa stand, aber es war doch recht ungemütlich ständig von diesen oft recht herrisch und übermütig sich benehmenden kahlköpfigen Gesellen in der roten Toga abhängig zu sein. Der Lama ist allgegenwärtig: hier zieht er hoch zu Ross, die kleine Gebetsmühle eifrig noch beim Reiten drehend, mit einer Karawane durch das Land, die vielleicht Proviant in ein weit abgelegenes Kloster bringt, dort wandert er allein hinaus, um in einem fernen Gehöft „die Trommel zu schlagen", d, h. Gottesdienst abzuhalten. Fast in jedem größeren Gehöft bocken Kahlköpfige ums Feuer und waren uns bisweilen recht unbequem, da die Hausbewohner uns nicht gestatten wollten, mit den heiligen Männern dasselbe Feuer zu benutzen.
Mit dem Gelübde der Keuschheit und Sittenstrenge geht es bei ihnen nach Aussage der chinesischen Beamten sowohl wie der Missionare genauso, wie es bei anderen Kongregationen mit besonderen Gelübden geht: die einen halten die Ordensregeln streng inne, die anderen scheren sich um nichts.
Unsere Erwartungen bezüglich der Rauheit des Gebirges waren durch die Erzählungen der Missionare ziemlich hochgespannt, wurden aber dennoch übertroffen. Schon am zweiten Tage stiegen wir zuerst noch auf zwar engem und teilweise verschneitem Pfad am Rande eines tief eingeschnittenen Gebirgstales aufwärts, dann aber wurde der Weg immer problematischer, verlor sieh hier in einem Geröllfeld, führte dort durch ein mit Eis und Schnee bedecktes Hochmoor, um zuletzt in scharfen Serpentinen zu einem scharfen, sturmgepeitschten Passgrat von 5000 m Höhe hinaufzuklettern.


Mensch und Tier litten täglich mehr unter der Luftverdünnung, das Steigen in diesen Höhen stellt an Lunge und Herz die höchsten Anforderungen und nur ganz langsames Steigen mit häufigen Pausen ermöglicht den Aufstieg. Auch die berggewohnten Tibetaner sahen wir unter dem Einfluss der Höhenluft leiden, nur die Yaks, die schwarzen Tibetochsen, machten ihren Weg, ohne außer Atem zu kommen. Die tieferen Täler sind mit Wald bedeckt, Nadelhölzer herrschen vor, doch finden sich auch Birken, Eichen, Stachellorbeer und an den Flüssen und Bächen Weiden und Pappeln. Waldbrände, welche durch vernachlässigte Lagerfeuer entstehen, scheinen häufig hier zu wüten und fast noch ärgere Verwüstungen richtet im Waldbestand eine Moosart an, welche in langen grüngrauen Flechten von allen Bäumen herabhängt und deren Wachstum erstickt. Erst bei 4000 m Höhe hört der Baumwuchs auf und Gras, niederes Heidekraut und Ginster decken die Hochsteppen, wenn nicht eisbedeckte Steinwüsten, rings umgeben von schneestarrenden Feldern, zu durchqueren sind.
Die Passhöhen sind fast durchweg mit Steinhaufen geziert, in welche Stöcke mit teils bunten, teils mit Sprüchen beschriebenen Fähnchen eingesteckt sind. Jeder Tibetaner murmelt im Vorbeigehen sein Gebet oder dreht eifriger seine Gebetsmühle und wirft einen Stein mehr auf einen der Steinhaufen.

Ost-Tibet: Gambu-Kette westlich Ranong (Lamaya). Auf der Passhöhe ein Mani mit Gebetswimpeln

Eine Spitze der Gambu-Kette. Im Vordergrund Obo, bedeckt mit Steinplatten, in die das lamaitische Gebet „Om mani padme hum“ eingemeißelt ist
Fast täglich überholen oder begegnen wir großen Karawanen, oft über hundert Köpfe stark, welche Tee nach Tibet hinein und tibetanische Erzeugnisse zurückbringen. Die Karawanenleute sind meist beritten, auch Frauen und Mädchen, im Männersitz auf Yaks und Ponies reitend ziehen mit. Sie sind gar nicht scheu, im Gegenteil, aus dem gellenden Gelächter der Männer und ihrem breiten Grinsen merken wir, dass diese Schönen offenbar mehr witzige als schmeichelhafte Bemerkungen über uns machen. Die Reiter sitzen mit sehr kurzen Bügeln reitend, auf einer Unzahl von Decken, Mantelsäcken und Taschen hoch über dem Sattel; das Zaumzeug ist bei wohlhabenden Leuten reich mit Metall, Muscheln, Tierschwänzen und buntem Tuch verziert. Die Tiere selbst sind klein, langhaarig und störrig, aber ausdauernd auch in diesem schlecht gangbaren Gelände und dabei sehr anspruchslos.
Die Nationaltracht mag in neuem Zustande recht kleidsam sein, man sieht sie aber meist in einer Verfassung, die jeder Beschreibung spottet. Das Hauptstück ist der weite lange Schafspelz, der mit den Haaren nach innen meist auf dem bloßen Körper getragen wird, da nur wenige begüterte Leute sich den Luxus eines Hemdes gestatten. Durch einen Gürtel zusammengehalten, wird der Pelz bis zum Knie aufgerafft, so dass sich oberhalb des Gürtels eine sackartige Falte bildet, in welcher die kleinen Gebrauchsgegenstände des täglichen Lebens verstaut werden. Wenn sich der Tibetaner den Luxus von Beinkleidern gestattet, so sind dieselben ebenfalls aus Fell gefertigt. Hohe Filz- oder Fellstiefel bis zum Knie schützen die Unterschenkel. Vornehmere Leute tragen Unmengen von Schmuck, mächtige silberne Fingerringe mit roten und grünen Halbedelsteinen, im linken Ohr ein großes Gehänge, silberne Schließen an Pelz und Hemd usw. Die Haartrachten sind außerordentlich verschieden. Dem einen hängen die schwarzen, meist gewellten Haare völlig natürlich um den Kopf, jener hat sich die Stirnhaare ins Gesicht gewöhnt und an den Augenbrauen abgeschnitten, ein anderer trägt seitlich an den Schläfen herabhängende Zöpfe wie die Czickos. Die meisten flechten ihr Haar mit vielen Seidenbändern verstärkt in einen dicken Zopf, den sie stets um den Kopf gewickelt tragen. Als besonderen Schmuck ziehen sie die Enden der Seidenbänder durch einen großen Elfenbeinring oder reihen eine ganze Anzahl der silbernen Fingerringe an ihnen auf. Fast jeder Tibetaner trägt als Waffe ein langes gerades Schwert in hölzerner, oft reich mit ziseliertem Silberbeschlag verzierter Scheide quer vor dem Leib, auf dem Rücken schaukelt sich die lange Luntenflinte mit der zweizinkigen Auflegegabel und an einem Bandelier um die Brust hängen eine Anzahl Pulvermasse.
Tibetanische Reiter



Jeder trägt einen Rosenkranz, viele auch silberne Götzenkästchen, sogenannte Gavos, sie murmeln beständig Gebete vor sich hin oder drehen die kleinen Gebetsmühlen. Zur Begrüßung stecken sie weit die Zunge hervor und erheben eine Hand mit emporgestrecktem Daumen und eingeschlagenen Fingern. Die Frauen tragen einen kürzeren Pelz wie die Männer darunter faltige Röcke aus buntem Wollstoff, Pulo genannt, die Stiefel sind dieselben wie die der Männer. Die Haartrachten wechseln sehr. Die Mädchen in Ta-tsien-lu scheiteln ihr Haar in der Mitte und flechten sich einen dicken Zopf, welchen sie um den Kopf wickeln; in der Gegend von Litang ist die Haartracht sehr kompliziert. Das Haar wird in eine Anzahl bleistiftstarke Zöpfe geflochten, die durch eine Schnur Glas-, Elfenbein- und Bernsteinperlen im Rücken zusammengehalten werden. Vom Scheitel herabfallen drei breite schwarze Seidenbänder, an denen oft 20 cm im Durchmesser messende gestanzte Silberplatten befestigt sind.



Einige tragen diese Platten auch seitlich am Kopf frei hochstehend angebracht, wie die Adlerflügel an einem altnordischen Helm. Wieder andere lassen eine breite Locke über die Nase herabfallen, die an der Nasenspitze gerade abgeschnitten wird. In Batang sahen wir bei einem Tanzfest die Mädchen in großem Schmuck, Perlketten und Götzenkästchen aus Silber, die Haare in mächtige Zöpfe mit unendlichem Aufwand von Seidenschnur geflochten. Auf dem Kopfe trugen sie mächtige Schlapphüte aus gelbgefärbtem Schaffell. In einigen Gegenden sind große Korallenzweige als Schmuck sehr beliebt. In Atentze trugen die Mädchen tellerartige Turbane aus rotem Stoff.


In dem von uns durchwanderten Gebiet wird sehr wenig Ackerbau getrieben. Desto zahlreicher sind die Herden von Kühen, Ziegen und Schafen. Während die Viehzucht treibenden Tibetaner größtenteils Nomaden sind und in Zelten wohnen, sieht man in den ackerbautreibenden Gegenden festungsartig finster aussehende Häuser, mächtige Stein- oder Lehmvierecke von zwei oder auch drei Stockwerken. Im untersten Stock ist nur eine Tür, durch sie gelangt man in einen Lichthof, der rings von offenen Viehställen umgeben ist.




Eine primitive Treppe, oft nur ein mit Kerben versehener Baumstamm, bildet die Verbindung mit dem zweiten Stock. Von der rings um den Lichthof laufenden Plattform gelangt man in einzelne Räume, die jeden Mobiliars entbehren, nur eine Feuerstelle befindet sich mitten im Zimmer, das durch ein Loch in der Wand, ein stets offenes Fenster, sein Licht erhält. Ein Loch in der Decke dient als Abzug für den Rauch, der aber trotzdem stets das ganze Haus erfüllt und die Augen unglücklicher Europäer beizt. Nur reiche Häuser haben eine Küche, wo blankes Kupfergeschirr und reichverzierte Butterfässer und Kannen auf dem Herde glänzen. Oft schaut ein arg verräuchertes Buddhabild in Flachrelief von der Wand hinter dem Herde auf das lebendige Treiben vor sich in milder Ruhe nieder. Die Beleuchtung geschieht mittels der Kienfackel. Vom ersten Stock führt eine ebenso primitive Stiege aufs Dach hinauf, wo Heu- und Strohvorräte aufgestapelt sind und Gebetsfahnen lustig im Winde flattern. Hier findet sich häufig noch ein Halbstock, meist bewohnt von Frauen. In abgeschiedenen Gegenden hausten wir bisweilen in wahren Hundehütten aus Stein, gegen welche solch tibetanisches Haus ein Palast zu nennen war, zumal wenn in holzreichen Gegenden der Oberstock aus mächtigen Baumstämmen im Blockhausstil aufgeführt war. Bisweilen findet man eine Reihe Gebetsmühlen in die Häuser eingebaut und in Zeiten des Nichtstuns setzt der gläubige Tibetaner diese Mühlen in Bewegung, um „Verdienst zu erwerben“. Einige Male sah ich auch Wind und Wasser herangezogen, um Gebetsmühlen zu treiben, also richtige Gebetswind- und -Wassermühlen, Noch einige andere religiöse Sitten seien hier erwähnt: In der Nähe tibetanischer Ortschaften findet man stets am Wege Steinpyramiden aufgestellt, belegt mit Steinplatten, auf welche in tibetanischen Schriftzeichen, oft bunt bemalt, meist das sechssilbige Gebet Om mane padme hum eingegraben ist. Oftmals sieht man ganze Reihen solcher Hügel längs des Weges errichtet. Auch über den Haustüren sind häufig Steinplatten mit diesem Gebet aufgehängt. Auf Pässen finden sich auch zuweilen kleine Kapellen, in denen Schriftrollen liegen. Die meisten waren vom Feuer zerstört. Bei Hoku am Nag-chu sahen wir eine solche Kapelle, in welcher Unmengen von etwa faustgroßen Lehmklumpen lagen von der Form noch nicht ganz entwickelter Fliegenpilze.
Das ganze Volk lebt von Tsamba, einem Gericht, welches aus Mehl, verriebenem Käse und Salz besteht und mit Tee in den kleinen hölzernen Essnäpfen zusammen geknetet wird. Fleisch wird nur selten genossen. Wein und Reisschnaps wird gern getrunken, meist zu viel, notabene, wenn der arme Tibetaner sich diesem Laster einmal hingeben kann. Tabak wird meist geschnupft, geraucht wird weniger. Das Opiumrauchen haben die chinesischen Beamten den Häuptlingen in den größeren Stationen ebenfalls schon beigebracht.

Über Litang, den grössten Ort zwischen Ta-tsien- lu und Batang hinaus, dessen von 3—4000 Mönchen bewohntes Lamakloster malerisch mit gold-bezinnten Tempeln in einem Bergsattel auf einer völlig öden Hochsteppe liegt, führt uns unser Weg südlich der höchsten Erhebung dieses Gebirgszuges entlang, des
7770 m hohen Nenda-Pick, dessen eine Spitze eine ziemlich große Ähnlichkeit mit dem Matterhorn hat.


Batang, der westlichste von uns berührte Punkt liegt etwa 2700 m über dem Meere am Ufer des Oberlaufes des Yangtse-kiang, welcher hier noch Kin - scha - kiang, Goldsandfluss, heißt.


Es ist die letzte Missionsstation gegen das verbotene Land hin, seit mehr als dreißig Jahren ist es von dieser Seite aus keinem Europäer geglückt, weiter vorzudringen. Hier führen die Spuren vieler Reisender hinaus, aber keine hinein. Auch unser Kommen war den beiden chinesischen Beamten und den Häuptlingen der Tibetaner angezeigt worden und angstvoll waren sie zu Mr. Mussot, dem französischen Missionar gelaufen, um ihn wegen unserer Pläne bezüglich des Weitermarsches auszuforschen. Groß war die Freude, als sie merkten, dass wir uns dem Süden zuwenden und nach Atentze weiterziehen wollten. Auf dem Marsche nach Atentze trafen wir eine grosse Karawane von Tibetanern, Männer und Frauen.

Mandarin in Batang

Mandarin Batang

Missionar Mussot in Batang

Dieselben waren auf einer Wallfahrt begriffen nach Bai-yüe-schan, einem großen Lamakloster von über 100 Tempeln, das in schon chinesischem Gebiet im Gebirgsstock Bai-ma-schan gelegen sein soll.
Über den über 5000 m hohen Tsalepass, vorbei an den mächtigen schneebedeckten Gebirgsstöcken
Bai-ma-schan und Chüe-schan-tai-tze, fast immer in starkbewaldeten Gebiet marschierend, erreichten wir wiederum den Kin-scha-kiang, den wir bei Pongsela überschritten.


Nun meinten wir der Lamaherrschaft entronnen zu sein, sahen aber unseren Irrtum bald ein. In Chung-tien-fu, der an einem fast ausgetrockneten See gelegenen Distriktshauptstadt, trat uns noch einmal so recht der Verfall und Rückgang der chinesischen Macht entgegen. Hier der chinesische Distriktbeamte in einem engen, schmutzigen Tempelchen, inmitten eines Gewirrs von niedrigen und schmutzigen Lehmhütten, und jenseits des nächsten Bergrückens die goldstrahlenden Zinnen der schneeweiß herüberwinkenden Tempelgebäude des Lamaklosters. Noch einmal gelangten wir in winterliche Regionen, ein wildes Waldgebirge, das hier in der vom Kin-scha-kiang gebildeten Schleife liegt, dann grüßt uns nach einem jähen Abstieg im jenseitigen Tal der schöne Frühling mit blühenden Bäumen und zwitschernden Vögeln.




Bei Achi überschritten wir nun zum letzten Male den Kin-scha-kiang und zwar den nach Nord umbiegenden Schleifenschenkel. Hier tragen die Frauen einen eigenartigen Schmuck, bestehend aus zwei großen, auf beiden Schultern angebrachten Rosetten, welche über den Rücken hin verbunden sind mit einer aus sieben kleinen Rosetten gebildeten Kette. Dies soll Sonne, Mond und Sterne darstellen.
In nun wieder rein chinesischem Gebiet eilten wir Ta-li-fu, der alten Hauptstadt der Provinz Yünnan am Errh-Hai, dem großen See zu, von dessen Herrlichkeiten uns der französische Generalkonsul in Tschöng-tu-fu Monsieur Bons d'Anty eine ganz begeisterte Schilderung entworfen hatte. Wir fanden nichts von allem, eine halb noch in Trümmern liegende, weit angelegte, aber schlecht erhaltene Stadt, die offenbar noch unter den Folgen der großen Mohammedanerrebellion der siebziger Jahre leidet.


Mittelturm in Ta-li-fu, Yünann


Gern wären wir noch einige Zeit in Yünnan geblieben, um wenigstens einen Blick tun zu können auf die sehr merkwürdigen Volkstämme dieser Gegend. Aber wir hatten unseren Urlaub schon überschritten und waren noch fern von dem Ziel unserer Reise. In südwestlicher Richtung marschierend überschritten wir die hohen Parallelketten, zwischen welchen der Salwen und der Mekong dem Meere zuströmen. In Teng-yüe oder Momein trafen wir die ersten Europäer, Mr. Litton, den englischen Konsul und einige Herren vom chinesischen Zollamt, welche durch ihre ans ungebundene grenzende Gastfreundschaft uns die Entbehrungen der letzten Monate vergessen machten. Von Momein aus führt eine alte Karawanenstraße durch das Gebiet der Schanvölker, der Bai-i und der Katschin hinüber nach Bhamo über die chinesisch-birmesische Grenze. Von Kulika an bis Bhamo, 51 englische Meilen, haben die Engländer eine ideale Straße gebaut, welche bis Momein von den Chinesen mit Hilfe englischer Ingenieure fortgesetzt werden soll. In glühendem Sonnenbrand, mitten durch tropischen Urwald zwischen Palmen, Bambus und Riesenfarnen, die sich mit Lianen und Schlingpflanzen zur undurchdringlichen Dschungel verfilzen, hindurch reiten wir gemächlich nach Bhamo hinunter.



Katschin, Grenze von Yünnan und Burma


Am 28. Februar 1904, nach einem Ritt von 4500 km sahen wir endlich die weiße Pagode von Bhamo auftauchen, wir sehen Tommy Atkins Fußball spielen, Häuser in europäischer Bauart winken uns, die Zivilisation ist wieder erreicht.

Von hier, wo die englischen Regierungsbeamten und die Offiziere der Garnison uns in der herzlichsten und gastfreiesten Weise aufnahmen trug uns Dampfer und Eisenbahn auf und am Irawadi entlang durch Birma hindurch nach Irawadi entlang durch Birma hindurch nach Rangoon, wo uns Hr. Scharnhorst, der deutsche Konsul, schon seit zwei Monaten erwartet hatte. Leider konnte es für uns keinen Aufenthalt mehr geben, nur mit Mühe erreichten wir durch eine Fahrt mit dem Dampfer nach Madras, mit der Bahn südlich bis Tuticorin und von dort hinüber nach Ceylon den Lloyddampfer Seydlitz in Colombo und schifften uns auf ihm nach der Heimat ein; trotz aller Erlebnisse und aller Reisefreuden nun doch froh, wieder geordneten Verhältnissen entgegen zu gehen.







Blick auf die Mole in Colombo bei starkem Wellengang



















Bericht in der „Deutsche Rundschau für Geographie und Statistik“ Band 27, 1905